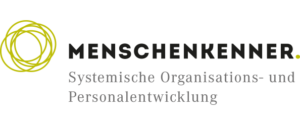“Wann bin ich mutig und akzeptiere Fehler als spannenden Prozess? Wann bin ich wach für Entwicklungen in meinem Umfeld? Wann übernehme ich gerne Verantwortung?”
Jörg Zander
Agilität, Kommunikation, Innovation, Führung, Improtheater
Wann funktioniert ein Spiel? Wann habe ich Spass am Tun? Wann bleibe ich wirklich dran? Wann bin ich mutig und akzeptiere Fehler als spannenden Prozess? Wann bin ich wach für Entwicklungen in meinem Umfeld? Wann übernehme ich gerne Verantwortung?
Dies sind Fragen, die mich schon seit meinen ersten Schritten meiner beruflichen Entwicklung beschäftigt haben. Das Gefühl, dass es auch irgendwie anderes gehen müsste, hat mich häufig begleitet. Erste tatsächliche Aha-Effekte, hatte ich dann bei einem Seminar 1998 bei Klaus Kobjol. Es folgten intensive Selbststudienjahre durch Unternehmensgründungen, Kooperationen, Seminaren etc.
Meine Entdeckung der Theater Improvisation im Jahre 2003 war für mich dann ein wirkliches Geschenk, um die o.g. Fragen besser beantworten zu können. Die Entdeckungsreise geht bis zum heutigen Tage weiter und hat mich mit wunderbaren Projekten in unterschiedlichen Ländern und Unternehmen in Kontakt gebracht.
Hierbei liegt mir seit einigen Jahren besonders am Herzen, junge Lehrer dabei zu unterstützen mutiger und agiler ihre täglichen Herausforderungen anzunehmen, um damit natürlich auch den Mut und die Neugier zukünftiger Schülergenerationen zu fördern.
Kontakt
zander@menschenkenner.de